Wir möchten dir zeigen, wie du ein Kleinunternehmen gründen kannst, ohne dich in Bürokratie zu verlieren. Vielleicht hast du schon eine Idee, die du endlich umsetzen willst. Oder du willst einfach testen, ob sich dein Hobby zum Nebenverdienst eignet. In jedem Fall ist ein Kleinunternehmen ideal, um mit wenig Risiko und überschaubarem Aufwand in die Selbstständigkeit zu starten.
Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff “Kleinunternehmen”? Häufig ist damit das sogenannte Kleingewerbe gemeint. Es zeichnet sich durch vereinfachte steuerliche Regeln aus und soll Gründern den Einstieg ins Business erleichtern. Für dich bedeutet das: weniger Papierkram und mehr Zeit, dich auf deine Geschäftsidee zu konzentrieren.
In dieser Checkliste gehen wir Schritt für Schritt durch alle wichtigen Punkte. Du erfährst, welche rechtlichen Grundlagen du kennen solltest, wie du einen soliden Businessplan erstellst und mit welchen Strategien du schnell die ersten Kunden gewinnen kannst. Nimm dir die Zeit, jeden Schritt gründlich zu verstehen, und du wirst merken: Ein Kleinunternehmen zu gründen ist gar nicht so kompliziert, wie es oft scheint.
Bevor wir uns den Details widmen, klären wir zunächst, was ein Kleinunternehmen rechtlich bedeutet. Anders als der Begriff vermuten lässt, handelt es sich nicht um eine eigene Rechtsform. Vielmehr geht es um eine steuerliche Vereinfachung im Umsatzsteuergesetz (§ 19 UStG).
Wenn dein Jahresumsatz (also das, was du brutto einnimmst) 22.000 Euro im Gründungsjahr nicht übersteigt und im Folgejahr nicht mehr als 50.000 Euro prognostizierst, kannst du von der sogenannten Kleinunternehmerregelung profitieren. Dadurch musst du in den meisten Fällen keine Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen. Das vereinfacht nicht nur deine Buchhaltung, sondern reduziert auch den Verwaltungsaufwand.
Allerdings gibt es einige Ausnahmen. Nicht jedes Gewerbe darf oder kann diese Vereinfachung in Anspruch nehmen. Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du entweder einen Steuerberater konsultieren oder dich direkt beim Finanzamt erkundigen. In den meisten Fällen bekommst du eine eindeutige Auskunft, ob du die Kleinunternehmerregelung anwenden darfst oder nicht.
Jede Gründung beginnt mit einer soliden Geschäftsidee. Du solltest dir folgende Fragen stellen: Was bietest du an, wer sind deine potenziellen Kunden und wie setzt du dich vom Wettbewerb ab? Es lohnt sich, genügend Zeit in diese Überlegungen zu investieren, denn deine Antworten bilden das Fundament für alle weiteren Schritte.
Wir empfehlen, zunächst ein einfaches Brainstorming durchzuführen. Schreibe dir alle Ideen auf, die dir in den Sinn kommen. Manchmal ist es hilfreich, sich auf Probleme zu konzentrieren, die du oder andere Menschen in ihrem Alltag haben. Gibt es ein Produkt oder eine Dienstleistung, die diese Probleme lösen kann?
Häufig entstehen die besten Businessideen aus persönlichen Herausforderungen. Vielleicht hast du ein Hobby, das du schon länger perfektionierst, oder du hast in deinem bisherigen Job eine Marktlücke entdeckt. Der Schlüssel ist, deine Ideen zu konkretisieren und zu prüfen, ob sie wirtschaftlich tragfähig sind.
Deine Geschäftsidee muss nicht völlig neu sein. Entscheidend ist, wie du dich von bestehenden Angeboten abhebst. Eine einfache Marktanalyse kann dir helfen, einen Überblick zu bekommen:
Wenn du merkst, dass der Markt sehr gesättigt ist, ist das nicht unbedingt ein Aus. Oft kannst du dich mit einem besonderen USP (Unique Selling Proposition) oder einem ausgezeichneten Kundenservice trotzdem durchsetzen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist goldwert, weil es dich aus der Masse der Anbieter heraushebt.
Die Zielgruppe ist das Herzstück deines Business. Sie entscheidet, wie du dein Angebot präsentierst, wie deine Preise aussehen und welche Kommunikationskanäle du nutzt. Überlege dir:
Mit einer klar umrissenen Zielgruppe kannst du deine Marketingmaßnahmen viel präziser ausrichten. Ob du Flyer verteilst, auf Social Media wirbst oder Mund-zu-Mund-Propaganda nutzt – du weißt, wo und wie du deine Zielgruppe erreichst.
Wenn wir von Kleinunternehmen sprechen, dann denken viele sofort an ein Kleingewerbe. Doch nicht alle Tätigkeiten sind automatisch gewerbepflichtig. In Deutschland gibt es Berufe, die als sogenannte Freie Berufe gelten. Sie sind nicht gewerbepflichtig und unterliegen anderen Regelungen. Dazu gehören beispielsweise Ärzte, Steuerberater, Künstler, Journalisten oder Heilpraktiker.
Falls deine Tätigkeit nicht in die Kategorie der Freien Berufe fällt, musst du in der Regel ein Gewerbe anmelden. Dabei kannst du entscheiden, ob du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst oder nicht. Der Vorteil liegt in der bereits erwähnten Befreiung von der Umsatzsteuer. Der Nachteil kann sein, dass du auf deinen Eingangsrechnungen (z. B. für Materialeinkauf) keine Vorsteuer abziehen kannst.
Gerade zu Beginn kann die Kleinunternehmerregelung aber sehr hilfreich sein, um den Papieraufwand zu reduzieren. Achte aber darauf, ob deine Kunden auf einen Vorsteuerabzug angewiesen sind. Wenn du zum Beispiel ausschließlich an Geschäftskunden lieferst, kann es sogar sinnvoller sein, auf die Regelung zu verzichten, weil deine Kunden die Umsatzsteuer meist zurückbekommen.
Um offiziell zu starten, musst du dein Gewerbe beim zuständigen Gewerbeamt anmelden. Das geht in vielen Städten mittlerweile auch online. Nach der Anmeldung schickt das Gewerbeamt deine Daten automatisch an das Finanzamt und an die zuständige IHK (Industrie- und Handelskammer) oder HWK (Handwerkskammer).
Im Anschluss erhältst du vom Finanzamt einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dort kannst du angeben, ob du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchtest. Achte darauf, alle Fragen korrekt und vollständig zu beantworten, damit es später keine unangenehmen Überraschungen gibt.
Sobald der Antrag bearbeitet ist, gilt dein Unternehmen als angemeldet. Du erhältst einen Gewerbeschein, den du gut aufbewahren solltest.
Über den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung registriert dich das Finanzamt als Kleinunternehmer (sofern du diese Option angekreuzt hast). Du bekommst außerdem eine Steuernummer, die du auf Rechnungen angeben musst.
Im Wesentlichen musst du dich mit folgenden Steuerarten auseinandersetzen:
Gerade am Anfang ist es ratsam, dich entweder gründlich selbst einzulesen oder einen Steuerberater hinzuzuziehen, damit du keine Fehler machst, die später teuer werden können.
Auch wenn du dein Kleinunternehmen erst einmal nur nebenberuflich startest, hilft ein Businessplan, die wesentlichen Punkte zu strukturieren und dein Konzept zu schärfen. Du brauchst keinen hochkomplexen Plan, wie ihn große Investoren verlangen würden. Aber ein kompakter, gut durchdachter Überblick kann dir sehr helfen.
Wenn du alle diese Punkte durchgehst, gewinnst du viel Klarheit darüber, wo dein Kleinunternehmen steht und wie es wachsen kann. Selbst wenn du kein Geld von einer Bank oder Investoren brauchst, wird dir diese Vorgehensweise enorm helfen, potenzielle Fallstricke früh zu erkennen.
In der Finanzplanung solltest du realistisch sein. Wie viel musst du investieren? Welche laufenden Kosten kommen auf dich zu? Wie viele Kunden brauchst du, um profitabel zu sein? Kalkuliere immer etwas Puffer ein, denn selten läuft es im ersten Jahr alles nach Plan.
Ein wichtiger Punkt sind die Rücklagen. Gerade bei Kleinunternehmern mit unregelmäßigem Einkommen kann es hilfreich sein, einen Teil des Gewinns zurückzulegen. So bist du vorbereitet, wenn größere Ausgaben anstehen oder unerwartete Kosten auf dich zukommen.
Ohne Kunden kein Umsatz, das ist klar. Deshalb solltest du dir schon vor dem Start deines Kleinunternehmens Gedanken machen, wie du an deine ersten Aufträge oder Verkäufe kommst. Eine durchdachte Marketingstrategie ist selbst für ein kleines Gewerbe unverzichtbar.
Heutzutage suchen die meisten Menschen online nach Produkten und Dienstleistungen. Eine Website, ein Blog oder ein Social-Media-Profil sind deshalb fast immer ratsam. Falls du schnell und unkompliziert Landing Pages oder Verkaufsseiten erstellen möchtest, gibt es Tools wie FunnelCockpit, die dir beim Aufbau helfen können.
Doch nur im Internet präsent zu sein, reicht nicht. Du musst regelmäßig Inhalte bereitstellen, die deine Zielgruppe ansprechen. Das können Blogartikel, Infografiken oder Videos sein. Wenn du dein Angebot als Lösung für konkrete Probleme präsentierst und dabei Mehrwert bietest, gewinnst du leichter das Vertrauen potenzieller Kunden.
Je nach Branche kann es sinnvoll sein, auch offline aktiv zu werden. Gerade wenn du einen lokalen Bezug hast, zum Beispiel im Handwerks- oder Dienstleistungsbereich, können Flyer in Geschäften oder persönliche Kontakte in Netzwerken wie einem Unternehmerstammtisch sehr hilfreich sein.
Sei ruhig kreativ. Vielleicht passen auch Workshops oder ein Tag der offenen Tür, um auf dein Angebot aufmerksam zu machen. Im persönlichen Gespräch kannst du deine Leidenschaft und Kompetenz oft besser rüberbringen als online.
Jeder zufriedene Kunde ist ein potenzieller Multiplikator. Mundpropaganda kann unschlagbar sein, vor allem am Anfang. Bitte deine Kunden aktiv um Feedback und Empfehlungen. Ein kurzer Hinweis wie “Wenn du zufrieden bist, erzähle gerne anderen von mir” kann Wunder wirken.
Auch kleine Treue- oder Dankeschön-Aktionen kommen gut an. Das können Gutscheine, ein kleiner Zusatzservice oder personalisierte Angebote sein. So bleibst du positiv im Gedächtnis und deine Kunden kommen gerne wieder.
Ein häufiger Stolperstein beim Kleinunternehmen gründen ist die Buchhaltung. Viele Gründer haben keine Lust auf Belege sortieren und Zahlen jonglieren. Aber keine Sorge, gerade als Kleinunternehmer hast du es einfacher als ein großes Unternehmen.
Du kannst nämlich eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) machen. Dabei hältst du nur Einnahmen und Ausgaben fest. Das ist deutlich weniger aufwendig als eine doppelte Buchführung. Einfache Tools oder auch Excel-Tabellen können hier schon ausreichen. Dennoch solltest du dich mit den Grundlagen beschäftigen:
Beachte zudem die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, die meistens 10 Jahre betragen. Digitale Ablage ist erlaubt, solange die Daten manipulationssicher sind und du jederzeit nachweisen kannst, woher sie stammen.
Selbst wenn du ein Kleingewerbe hast, ist es ratsam, ein separates Geschäftskonto zu führen. Das muss nicht unbedingt ein teures Geschäftskonto sein – auch ein zweites Girokonto kann reichen, solange du sicherstellst, dass dort ausschließlich geschäftliche Transaktionen stattfinden.
Die Trennung verhindert, dass du am Jahresende den Überblick verlierst und ermöglicht eine klare Darstellung deiner Einnahmen und Ausgaben.
Um dich weniger mit Verwaltung beschäftigen zu müssen, kannst du viele Abläufe automatisieren. Nutze zum Beispiel Online-Buchhaltungsprogramme, die deine Rechnungen speichern und deine Einnahmen-Überschuss-Rechnung vorbereiten.
Im Marketing-Bereich gibt es CRM- und E-Mail-Marketing-Tools, um Kundenkontakte zu pflegen und automatisierte E-Mails zu versenden. Hier bietet sich eine All-in-One-Lösung wie FunnelCockpit an, in der du Landing Pages, E-Mail-Marketing und CRM miteinander verknüpfen kannst. So sparst du Zeit und behältst den Überblick.
Auch wenn du klein startest, solltest du dich mit dem Thema Versicherung beschäftigen. Abhängig von deiner Branche können bestimmte Versicherungen sinnvoll oder sogar vorgeschrieben sein.
Nicht alles ist zwingend nötig, aber je nachdem, was du anbietest, kann eine entsprechende Versicherung viel Ärger ersparen und dir ein sicheres Gefühl geben.
Du hast dein Kleinunternehmen erfolgreich gestartet und die ersten Kunden gewonnen? Großartig! Doch was kommt als Nächstes? Sobald du merkst, dass deine Umsätze steigen und du die Grenze von 22.000 Euro Umsatz pro Jahr erreichst, solltest du überlegen, wie du langfristig wachsen willst.
Wenn du mehr als 22.000 Euro im ersten Jahr oder mehr als 50.000 Euro im Folgejahr erwirtschaftest, fällst du aus der Kleinunternehmerregelung heraus. Dann musst du Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen und regelmäßig Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben. Das ist ein Mehraufwand, öffnet dir aber auch neue Möglichkeiten: du kannst Vorsteuer beim Einkauf geltend machen.
Denke daran, dass mit jeder Wachstumsetappe auch neue Herausforderungen kommen: mehr Buchhaltungsaufwand, eventuell neue Steuern und höhere Versicherungskosten. Plane also rechtzeitig und strukturiert, damit dein Übergang vom Kleinunternehmen ins reguläre Unternehmen reibungslos gelingt.
Auch wenn ein Kleingewerbe viele Vereinfachungen bietet, lauern einige typische Fehler. Wir möchten dich dafür sensibilisieren, damit du diese Stolpersteine umgehen kannst.
Am wichtigsten ist es, dranzubleiben und offen für Neues zu sein. Fehler gehören zum Unternehmeralltag dazu. Sie sind oft eine großartige Gelegenheit, aus praktischen Erfahrungen zu lernen und dein Business zu verbessern.
Nachhaltiger Erfolg bedeutet, dass dein Kleinunternehmen über Jahre hinweg profitabel bleibt und du dich kontinuierlich weiterentwickelst. Dabei spielt nicht nur das Einkommen eine Rolle, sondern auch, wie zufrieden du und deine Kunden sind.
Hier sind ein paar Tipps, die dir helfen können, dein Business langfristig auf stabile Füße zu stellen:
Gerade am Anfang zahlt sich Engagement aus. Zeig deinen Kunden, dass du für sie da bist, und nutze jede Möglichkeit, dich zu verbessern. Qualität setzt sich langfristig durch – und zufriedene Kunden sind dein nachhaltigster Erfolgsfaktor.
Frage 1: Was passiert, wenn ich die Umsatzgrenze von 22.000 Euro überschreite?
Wenn du im ersten Jahr mehr als 22.000 Euro Umsatz machst, fällst du schon ab dem folgenden Jahr aus der Kleinunternehmerregelung heraus. Du musst dann Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen und eine Umsatzsteuer-Voranmeldung einreichen.
Frage 2: Ist eine Gewerbeanmeldung immer notwendig?
Nicht immer. Wenn du einen Freien Beruf ausübst (z. B. als Künstler, Journalist oder Arzt), bist du nicht gewerbepflichtig. In diesem Fall musst du dein Geschäft aber beim Finanzamt anmelden und eine Steuernummer beantragen.
Frage 3: Kann ich ein Kleinunternehmen nebenberuflich führen?
Ja, du kannst dein Kleinunternehmen auch neben einem Hauptjob starten. Wichtig ist, dass dein Arbeitgeber informiert ist (sofern es in deinem Arbeitsvertrag steht) und es keine Konkurrenzsituation zu deinem Angestelltenverhältnis gibt.
Frage 4: Muss ich als Kleinunternehmer tatsächlich keine Umsatzsteuer zahlen?
Nicht ganz. Du stellst zwar Rechnungen ohne Umsatzsteuer aus, aber wenn du beispielsweise Waren aus dem EU-Ausland beziehst oder Dienstleistungen aus dem Ausland beziehst bzw. im Ausland erbringst, können Sonderfälle auftreten. Informiere dich genau oder frag einen Steuerberater.
Frage 5: Wie schreibe ich eine Rechnung als Kleinunternehmer?
Eine Kleinunternehmer-Rechnung enthält keine Umsatzsteuer, muss aber den Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG beinhalten. Außerdem gehören dein Name, deine Anschrift, die Steuernummer, eine fortlaufende Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, Leistungsbeschreibung und der zu zahlende Betrag in die Rechnung.
Ein Kleinunternehmen zu gründen ist für viele der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Es ist eine großartige Möglichkeit, deine Ideen mit wenig Risiko und bürokratischem Aufwand zu testen. Wenn du sorgfältig vorgehst, deine Zielgruppe gut kennst und eine klare Vision hast, steht deinem Erfolg nichts im Weg.
Wichtig ist vor allem, dass du dranbleibst: Arbeite an deiner Idee, optimiere deine Prozesse und scheue dich nicht, Hilfe zu suchen, wenn du mal nicht weiterweißt. Mit einem soliden Plan, cleverem Marketing und einer Prise Unternehmergeist kannst du dir ein lukratives Standbein aufbauen – oder sogar den Grundstein für etwas viel Größeres legen. Wir wünschen dir viel Erfolg!
Weitere interessante Inhalte:
Weitere Services
Rechtliches
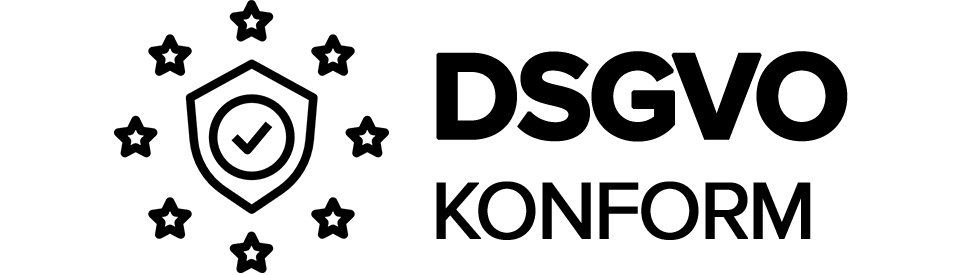
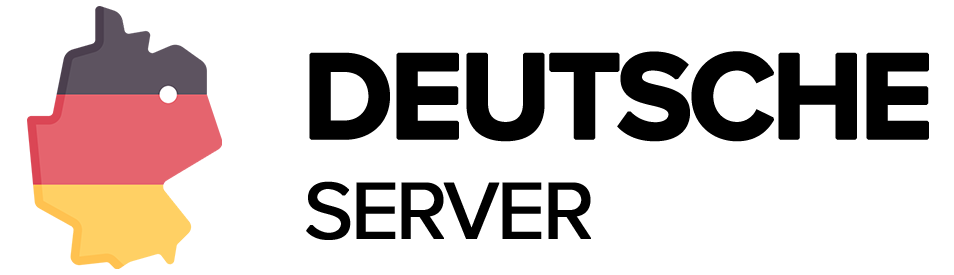
© FunnelCockpit.com